 Diese Seite wurde seit 2 Jahren inhaltlich nicht mehr aktualisiert.
Unter Umständen ist sie nicht mehr aktuell.
Diese Seite wurde seit 2 Jahren inhaltlich nicht mehr aktualisiert.
Unter Umständen ist sie nicht mehr aktuell.
 Zusammenfassungen
Zusammenfassungen
 Um besser zu verstehen, vor welchen Fragen und Aufgaben Lehrer*innen in Deutschland in den Schuljahren 2019/2020 und 2020/2021 hinsichtlich des Einsatzes von digitalen Medien standen und mit welchen digitalen Medien Schulen versucht haben, Unterricht auf Distanz zu ermöglichen, stellen wir im Folgenden die Auswertung zweier Datenkorpora vor, die im Rahmen des Verbundprojektes DATAFIED erhoben wurden. Während Twitter-Tweets mit dem Hashtag #twitterlehrerzimmer und #twlz den einen Datenkorpus bilden, umfasst der andere Datenkorpus fünfzehn online geführte Interviews mit sieben Lehrer*innen aus drei Projektschulen. Die Analyse bezieht sich auf drei relevante Zeiträume im Verlauf der pandemiebedingten Schulschließungen: (1) das Frühjahr 2020 kurz nach den ersten Schulschließungen, (2) den Sommer 2020 kurz vor den Sommerferien und (3) um das Frühjahr 2021, also ein Jahr nach den ersten landesweiten Schulschließungen. Die jeweiligen thematischen Schwerpunkte bzw. Interessen variieren und lassen sich für die aufgeführten Zeiträume aufzeigen. Doch ob diese Interessen der Community anders oder gleich jenen der Lehrer*innen in der Praxis der Projektschulen ist, wollen wir versuchen, mit der Zusammenschau beider Datenkorpora zu beantworten.
Um besser zu verstehen, vor welchen Fragen und Aufgaben Lehrer*innen in Deutschland in den Schuljahren 2019/2020 und 2020/2021 hinsichtlich des Einsatzes von digitalen Medien standen und mit welchen digitalen Medien Schulen versucht haben, Unterricht auf Distanz zu ermöglichen, stellen wir im Folgenden die Auswertung zweier Datenkorpora vor, die im Rahmen des Verbundprojektes DATAFIED erhoben wurden. Während Twitter-Tweets mit dem Hashtag #twitterlehrerzimmer und #twlz den einen Datenkorpus bilden, umfasst der andere Datenkorpus fünfzehn online geführte Interviews mit sieben Lehrer*innen aus drei Projektschulen. Die Analyse bezieht sich auf drei relevante Zeiträume im Verlauf der pandemiebedingten Schulschließungen: (1) das Frühjahr 2020 kurz nach den ersten Schulschließungen, (2) den Sommer 2020 kurz vor den Sommerferien und (3) um das Frühjahr 2021, also ein Jahr nach den ersten landesweiten Schulschließungen. Die jeweiligen thematischen Schwerpunkte bzw. Interessen variieren und lassen sich für die aufgeführten Zeiträume aufzeigen. Doch ob diese Interessen der Community anders oder gleich jenen der Lehrer*innen in der Praxis der Projektschulen ist, wollen wir versuchen, mit der Zusammenschau beider Datenkorpora zu beantworten. In dem Beitrag Kap. „Pandemiebedingte Schulschließungen und die Nutzung digitaler Technologien. Welchen Einblick Twitter- und Interviewanalysen geben können“ von Ben Mayer, Sieglinde Jornitz, Irina Zakharova, Juliane Jarke und Yan Brick zeichnen sich Spannungen in Bezug auf die Twitter-Debatten und die im Alltag, einzelner Schulen entfaltete Diskussion zur Verwendung digitaler Medien für schulische Zwecke in der Pandemie ab. Die Autor*innen gehen der Frage nach, mit welchen digitalen Medien und Softwarelösungen Schulen während der Pandemie versucht haben, Unterricht auf Distanz herzustellen. Die Datenbasis bilden zwei Datenkorpora –Twitter-Tweets mit dem Hashtag #twitterlehrerzimmer und #twlz und Leitfadeninterviews mit Lehrenden unserer DATAFIED-Projektschulen. Einerseits blicken die Autor*innen in Nahaufnahme auf Lehrendenerfahrungen in der Pandemie und andererseits aus der Vogelperspektive auf die im deutschsprachigen Raum geführte allgemeine Diskussion zu Anwendungsszenarien digitaler Medien, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einer Bildungspraxis-Community und den spezifischen Interessen der Lehrkräfte an den Projektschulen herauszulesen. Der Beitrag zeichnet die Entwicklung thematischer Schwerpunkte in Bezug auf digitale Medien im Verlauf der Schulschließungen während der Pandemie nach. So werden sowohl Entwicklungstendenzen in drei der DATAFIED-Projektschulen nachgezeichnet, als auch die sich in Twitter-Tweets spiegelnden Schwerpunktsetzungen von auf Twitter aktiven Lehrkräften rekonstruiert. In den Twitter-Tweets identifizieren Ben Mayer, Sieglinde Jornitz, Irina Zakharova, Juliane Jarke und Yan Brick für die erste Phase der Schulschließungen zunächst einen vermehrten Austausch über Tools für kollaboratives Arbeiten sowie Interesse am Ausprobieren „digitaler Möglichkeiten“. In der zweiten Phase liegt der Schwerpunkt auf dem Austausch zur Etablierung von Softwarelösungen. Die dritte Phase ist schließlich von einer gewissen Verwendungsroutine gekennzeichnet. Während Schulen und Lehrende in der ersten Phase verstärkt nach digitalen Lösungen suchten, beispielsweise um durch die Reaktivierung oder Etablierung von Plattformangeboten mit Schüler*innen über die Distanz hinweg in Kontakt zu bleiben, war die zweite Phase gekennzeichnet durch eine Engführung auf die Softwareprodukte, die bisher von der Schulleitung zur Verfügung gestellt und den Lehrenden bekannt waren. Die dritte Phase wiederum war stark geprägt von Fragen danach, wie trotz des Distanzunterrichts zu benoten sei. Indem beide Analysen der Datenkorpora in BeDatafizierte
Gesellschaft | Bildung | Schule
zug zueinander gesetzt werden, können die Autor*innen zeigen, dass Twitter als ein „Diskursraum“ fungiert, in dem tendenziell die großen Visionen von Potenzialen digitaler Medien für das Unterrichten über das Bestehende hinaus ausgelotet werden, während die interviewten Lehrkräfte eingebunden sind in die je konkreten pädagogisch, technisch und rechtlich regulierenden Gegebenheiten in ihren Schulen. Der Beitrag gibt unter anderem Einblicke in das Spannungsverhältnis zwischen größtmöglicher Freisetzung des Machbaren mit digitalen Technologien und teils restriktiver Umsetzung im alltäglichen Unterricht und in der Schule.
In dem Beitrag Kap. „Pandemiebedingte Schulschließungen und die Nutzung digitaler Technologien. Welchen Einblick Twitter- und Interviewanalysen geben können“ von Ben Mayer, Sieglinde Jornitz, Irina Zakharova, Juliane Jarke und Yan Brick zeichnen sich Spannungen in Bezug auf die Twitter-Debatten und die im Alltag, einzelner Schulen entfaltete Diskussion zur Verwendung digitaler Medien für schulische Zwecke in der Pandemie ab. Die Autor*innen gehen der Frage nach, mit welchen digitalen Medien und Softwarelösungen Schulen während der Pandemie versucht haben, Unterricht auf Distanz herzustellen. Die Datenbasis bilden zwei Datenkorpora –Twitter-Tweets mit dem Hashtag #twitterlehrerzimmer und #twlz und Leitfadeninterviews mit Lehrenden unserer DATAFIED-Projektschulen. Einerseits blicken die Autor*innen in Nahaufnahme auf Lehrendenerfahrungen in der Pandemie und andererseits aus der Vogelperspektive auf die im deutschsprachigen Raum geführte allgemeine Diskussion zu Anwendungsszenarien digitaler Medien, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einer Bildungspraxis-Community und den spezifischen Interessen der Lehrkräfte an den Projektschulen herauszulesen. Der Beitrag zeichnet die Entwicklung thematischer Schwerpunkte in Bezug auf digitale Medien im Verlauf der Schulschließungen während der Pandemie nach. So werden sowohl Entwicklungstendenzen in drei der DATAFIED-Projektschulen nachgezeichnet, als auch die sich in Twitter-Tweets spiegelnden Schwerpunktsetzungen von auf Twitter aktiven Lehrkräften rekonstruiert. In den Twitter-Tweets identifizieren Ben Mayer, Sieglinde Jornitz, Irina Zakharova, Juliane Jarke und Yan Brick für die erste Phase der Schulschließungen zunächst einen vermehrten Austausch über Tools für kollaboratives Arbeiten sowie Interesse am Ausprobieren „digitaler Möglichkeiten“. In der zweiten Phase liegt der Schwerpunkt auf dem Austausch zur Etablierung von Softwarelösungen. Die dritte Phase ist schließlich von einer gewissen Verwendungsroutine gekennzeichnet. Während Schulen und Lehrende in der ersten Phase verstärkt nach digitalen Lösungen suchten, beispielsweise um durch die Reaktivierung oder Etablierung von Plattformangeboten mit Schüler*innen über die Distanz hinweg in Kontakt zu bleiben, war die zweite Phase gekennzeichnet durch eine Engführung auf die Softwareprodukte, die bisher von der Schulleitung zur Verfügung gestellt und den Lehrenden bekannt waren. Die dritte Phase wiederum war stark geprägt von Fragen danach, wie trotz des Distanzunterrichts zu benoten sei. Indem beide Analysen der Datenkorpora in BeDatafizierte
Gesellschaft | Bildung | Schule
zug zueinander gesetzt werden, können die Autor*innen zeigen, dass Twitter als ein „Diskursraum“ fungiert, in dem tendenziell die großen Visionen von Potenzialen digitaler Medien für das Unterrichten über das Bestehende hinaus ausgelotet werden, während die interviewten Lehrkräfte eingebunden sind in die je konkreten pädagogisch, technisch und rechtlich regulierenden Gegebenheiten in ihren Schulen. Der Beitrag gibt unter anderem Einblicke in das Spannungsverhältnis zwischen größtmöglicher Freisetzung des Machbaren mit digitalen Technologien und teils restriktiver Umsetzung im alltäglichen Unterricht und in der Schule. Dieser wissenschaftliche Zeitschriftenartikel erwähnt ...
Dieser wissenschaftliche Zeitschriftenartikel erwähnt ...
 Personen KB IB clear | Andreas Hepp , Juliane Jarke , Leif Kramp , Rolf Schulmeister | |||||||||||||||||||||||||||
 Begriffe KB IB clear | Barcamp
,  Corona-Pandemie
, Corona-Pandemie
,  Deutschland Deutschland germany
, germany
,  Digitalisierung
, Digitalisierung
,  itslearning
, itslearning
,  Learning Management System (LMS) / Lernplattform Learning Management System (LMS) / Lernplattform Learning Management System
, Learning Management System
,  LehrerIn LehrerIn teacher
, teacher
,  Moodle
, Moodle
,  Schule Schule school
, school
,  Schulleitung
, Schulleitung
,  Schulschliessung aufgrund Corona-Pandemie
, Schulschliessung aufgrund Corona-Pandemie
,  Software Software software
, software
,  Twitter
, Twitter
,  Unterricht
, Unterrichtsmaterial
, Unterricht
, Unterrichtsmaterial
,  Video-Konferenz Video-Konferenz Video-Konferenz
, Video-Konferenz
,  WhatsApp WhatsApp
| |||||||||||||||||||||||||||
 Bücher |
|
 Dieser wissenschaftliche Zeitschriftenartikel erwähnt vermutlich nicht ...
Dieser wissenschaftliche Zeitschriftenartikel erwähnt vermutlich nicht ... 
 Nicht erwähnte Begriffe | Bildung, distance learning / Fernunterricht, Kinder, Lernen, Primarschule (1-6) / Grundschule (1-4), Schweiz |
 Tagcloud
Tagcloud
 Zitationsgraph
Zitationsgraph
 Zitationsgraph (Beta-Test mit vis.js)
Zitationsgraph (Beta-Test mit vis.js)
 Anderswo finden
Anderswo finden
 Volltext dieses Dokuments
Volltext dieses Dokuments
 |  Pandemiebedingte Schulschließungen und die Nutzung digitaler Technologien. Welchen Einblick Twitter- und Interviewanalysen geben können: Artikel als Volltext @ Springer ( Pandemiebedingte Schulschließungen und die Nutzung digitaler Technologien. Welchen Einblick Twitter- und Interviewanalysen geben können: Artikel als Volltext @ Springer ( : :  , 713 kByte; , 713 kByte;  : :  ) ) |
 Anderswo suchen
Anderswo suchen 
 Beat und dieser wissenschaftliche Zeitschriftenartikel
Beat und dieser wissenschaftliche Zeitschriftenartikel
Beat hat Dieser wissenschaftliche Zeitschriftenartikel während seiner Zeit am Institut für Medien und Schule (IMS) ins Biblionetz aufgenommen. Er hat Dieser wissenschaftliche Zeitschriftenartikel einmalig erfasst und bisher nicht mehr bearbeitet. Beat besitzt kein physisches, aber ein digitales Exemplar. Eine digitale Version ist auf dem Internet verfügbar (s.o.). Es gibt bisher nur wenige Objekte im Biblionetz, die dieses Werk zitieren.







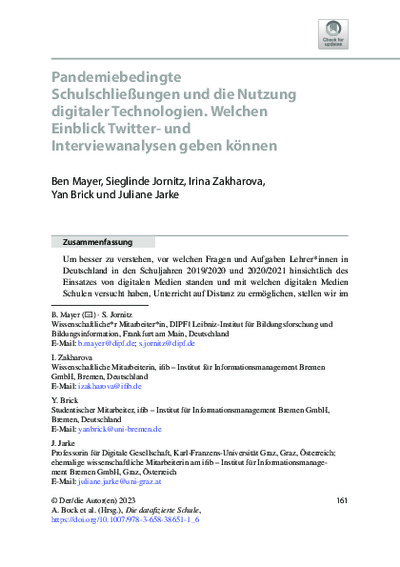




 Biblionetz-History
Biblionetz-History